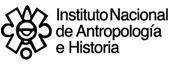

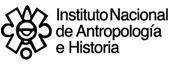

Artículos
Neue Strömungen in der Denkmalpflege
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodizität: Bianual
num. 5, 2018

Katechismus der Denkmalpflege
Originale Veröffentlichung: Max Dvořák (1916) Katechismus der Denkmalpflege, Julius Bard Verlag, Wien.
Einleitung
Was ist Denkmalpflege?
Ein Beispiel möge es erläutern.
Wer das Städtchen N. vor dreißig Jahren besuchte, konnte sich nicht wenig an dem anmutigen Bilde des alten schönen Ortes erfreuen. Den Mittelpunkt bildete die altersgraue gotische Pfarrkirche mit ihrem barocken Turm und einer schönen barocken Inneneinrichtung, feierlich und einladend und tausendfach mit Erinnerungen verknüpft.
Und wer Zeit und Lust hatte, konnte in der Kirche viele schöne Sachen näher besichtigen: Alte Tafelgemälde, kunstvoll geschnitzte Altäre, prächtige Paramente, zierliche Gold- und Silberarbeiten, die in der Sakristei aufbewahrt wurden.
Von der Kirche kam man durch ein Gewirr von alten kleinen Häuschen, die die hohe Kirche um so imposanter erscheinen ließen, auf den freundlichen Stadtplatz, wo man das ehrwürdige Rathaus aus dem XVII Jh. mit einem gemütlichen Zwiebelturm bewundern konnte. Breitspurige solide Bürgerhäuser ohne falsche und überflüssige Verzierungen und doch schmuck, alle mit Laubergängen versehen und in der Höhe beschränkt, schlossen sich daran, bescheiden dem Gesamtbilde des Platzes sich unterordnend, das in seiner geschlossenen Einheit trotz der verschiedenen Entstehungszeit der Häuser in jedem kunstsinnigen Beschauer die Empfindung einer künstlerischen Harmonie und in jedem empfindsamen Menschen überhaupt ähnliche Gefühle, wie die trauten Räume eines alten Familienhauses, hervorrufen mußte. Umgeben war das Städtchen von halbverfallenen, mit Schlingpflanzen bewachsenen Befestigungsmauern, an denen eine bequeme und abwechslungsreiche Promenade hinführte und die von vier stattlichen Stadttoren unterbrochen einen höchst malerischen Anblick boten.
Heute würde der Besucher das Städtchen, das er vor dreißig Jahren sah, kaum wiedererkennen.
Die alte Pfarrkirche wurde „restauriert“. Man hat den barocken Turm abgetragen und ihn durch einen neuen falsch-gotischen ersetzt, der in das Stadtbild wie eine Vogelscheuche in einen Rosengarten paßt. Die prächtigen Altäre wurden unter dem Vorwande, daß sie mit dem Stil der Kirche nicht übereinstimmen, hinausgeworfen und durch plumpe, geschmacklose, angeblich gotische, doch in der Wirklichkeit stillose Fabrikware ersetzt. Die einst einfach getünchten Wände sind jetzt mit schreienden Farben und sinnlosen Ornamenten bedeckt und so ist dem Kircheninnern der letzte Rest einer der hohen Bestimmung würdigen Gestaltung genommen; und als ich den Sakristan nach den alten Meßgewändern und Goldschmiedearbeiten frug, bedeutete mir seine verlegene Miene, daß sie längst an irgendeinen Antiquitätenhändler verschachert seien.

Noch weit ärger war jedoch die Verwüstung in der Nachbarschaft der Kirche. Die alten Häuschen wurden rasiert und durch einen sogenannten Park ersetzt, in dem einige verkümmerte Sträucher dahinwelkten. In dieser Umgebung sah auch die einst so imposante Kirche langweilig und verkümmert aus.
Und so ging‘s weiter.
Das köstliche alte Rathaus wurde demoliert, hat einem Neubau Platz gemacht, der ein Mittelding zwischen Kaserne und Ausstellungsbude darstellt. Die trauten Bürgerhäuser mußten abscheulichen, schwindelhaft aus billigem Material und nach Vorlagebüchern ohne geringste Spur einer künstlerischen Empfindung ausgeführten Miets- und Warenhäusern weichen. Die Stadttore wurden unter dem Vorwande, daß sie den – nicht bestehenden – Verkehr hindern, abgetragen, die Stadtmauern niedergerissen, damit sich die Stadt einmal – vielleicht in hundert Jahren – erweitern könne. So blieb aber von der einstigen Schönheit des Städtchens nur wenig übrig, ohne daß irgendein künstlerischer Ersatz geschaffen worden wäre.
Solche Verluste und Verwüstungen zu verhindern, ist die Aufgabe der Denkmalpflege.
I. Gefahren, die alten Denkmälern drohen
Es ist die wichtigste Aufgabe der Denkmalpflege, dahin zu wirken, daß alte Denkmäler erhalten bleiben.
Wenn auch das böswillige, sinnlose allgemeine Wüten gegen Zeugnisse der Vergangenheit, wie es früher in Kriegen und Revolutionen üblich war und zu dessen Abwehr der öffentliche Denkmalschutz im vorigen Jahrhundert begründet wurde, nicht mehr besteht, so sind doch die Gefahren, die den alten Kunstbesitz bedrohen, noch immer sehr groß.
Sie beruhen:
2. auf Habsucht und Betrug
3. auf mißverstandenen Fortschrittsideen und Forderungen der Gegenwart
4. auf unangebrachter Verschönerungs- und Neuerungssucht, künstlerischer Unbildung oder Verbildung.
Diese wichtigsten Ursachen, auf die ein ununterbrochener Verlust von alten Kunstwerken zurückzuführen ist, bestehen nicht etwa nur in Irrtümern einzelner, sondern sind eine allgemeine Erscheinung, die näher beleuchtet werden muß.
1. Zerstörung oder Verunstaltung alter Kunstwerke aus Unwissenheit und Indolenz
Wie groß die Schäden sind, die krasse Unwissenheit jahraus, jahrein dem Denkmalbestande zufügt, davon kann man sich leider fast überall überzeugen. Die Zeiten, wo man alte Archive an den Kaufmann als Packpapier verkaufte oder verbrannte, sind gottlob vorbei, da das Verständnis für den Wert alter Urkunden in die breitesten Schichten gedrungen ist. Doch wie weit ist man noch immer davon entfernt auf dem Gebiete der alten Kunst! Kein Museum der Welt ist so groß, um all das fassen zu können, was in Österreich in den letzten Jahrzehnten aus Ignoranz an alten Kircheneinrichtungsgegenständen, Altären, Orgelgehäusen, Kanzeln, Chorgestühlen, Gemälden verbrannt oder an den Trödler verkauft wurde. Nach wie vor werden alte Statuen zertrümmert oder aus den Kirchen hinausgeworfen, Wandgemälde von den Wänden heruntergeschlagen oder nach der Auffindung wieder übertüncht, alte Stadtmauern als Steinbruch benutzt und schöne gut erhaltene Bauten, Brunnen, Bildstöcke grundlos zerstört. Es wäre eine endlose Liste, wenn man all das zusammenstellen würde, was nur in den letzten Jahren in Österreich an alten Kunstwerken aus Verständnislosigkeit vernichtet wurde. Man könnte sich darüber wundern, wenn man bedenkt, wieviel seit fast hundert Jahren für die Verbreitung kunsthistorischer Kenntnisse geschieht. Kunsthistorisches Wissen trägt sicher viel dazu bei, die Aufmerksamkeit auf alte Kunstwerke zu lenken, doch reicht es allein nicht aus. Man kann es nicht bei jedem Menschen voraussetzen und es muß selbstverständlich mehr oder weniger allgemeiner Natur sein und kann sich nicht auf alle Schöpfungen der lokalen Kunst erstrecken, deren Geschichte man vielfach noch gar nicht kennt.
Doch was überall geweckt werden kann, was sich jedermann ohne besondere Studien und Spezialkenntnisse aneignen kann, wenn er nur guten Willen hat, ist Pietät für alles historisch Gewordene. Das ist nicht nur eine Frage der Kenntnisse oder besser gesagt fast gar nicht, sondern eine Frage der allgemeinen Bildung des Geistes und des Charakters. Menschen, die Andenken an ihre Eltern und Voreltern, mögen sie kostbar oder bescheiden sein, mit den Füßen treten und auf den Kehrichthaufen werfen, sind roh und gefühllos, zugleich aber Feinde ihrer Familie, weil sie sinnfällige Zeugnisse von Empfindungen vernichten, auf denen all das beruht, was im Rahmen des Familienlebens dem menschlichen Dasein einen höheren seelischen Inhalt verleiht.
Nicht anders ist es aber mit allem, was in den großen religiösen, staatlichen oder nationalen Gemeinschaften, in der Kirche und in einer Stadt, in einem Land und in einem Reich geeignet ist, die Erinnerung an die historische Vergangenheit und Zusammengehörigkeit zu erhalten oder wachzurufen. Das sind in erster Linie Werke der Kunst, der sichtbare Ausdruck dessen, was im Gefühlsleben und in der Phantasie die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft, und ein Ahnenvermächtnis, das zu ehren eine moralische Pflicht ist, die jedem in Fleisch und Blut übergehen soll, wie die Achtung vor fremdem Eigentum. Ein Priester, der Werke der alten kirchlichen Kunst grundlos zerstört, versündigt sich nicht nur an Kunst und Wissenschaft, sondern untergräbt zugleich sittliche Mächte, die zu den wichtigsten Stützen des religiösen Lebens gehören. Mit einem alten Altar, mit einer alten Kapelle schwinden auch tausendfache Erinnerungen, die den Dorf- und Stadtbewohnern heilig waren und ihnen in den Lebenstürmen einen innern Halt gegeben haben. Und ähnlich gehen mit alten Rathäusern, Stadttoren, Plätzen reiche Quellen des Gemeinsinnes und der Vaterlandsliebe zugrunde, und wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines Vaterlandes. Er schädigt die Allgemeinheit, denn die öffentlichen Kunstwerke sind nicht nur für diesen oder jenen Menschen geschaffen worden, und was sie an Kunstwert, an malerischem Zauber, an Erinnerungen oder sonstigem Gefühlsinhalt verkörpern, ist nicht minder Gemeingut wie die Schöpfungen der großen Dichter oder die Errungenschaften der Wissenschaft.
Das zu wissen, muß von jedem Gebildeten gefordert werden.
Neben der verständnislosen oder böswilligen Zerstörung verursacht auch die indolente Vernachlässigung noch immer dem alten Denkmalbestande den größten Schaden. Wie oft werden alte schöne Gemälde oder Statuen zwar nicht vernichtet, wohl aber aus der Kirche auf den Dachboden, in eine Rumpelkammer, in ein feuchtes Gewölbe verbannt, wo sie durch Ruß und Staub oder Feuchtigkeit rasch zugrunde gehen. Es ist eine leider sehr häufige Tatsache, daß alte Bauwerke, Bildwerke, Altäre, an denen sich noch viele Generationen hätten erfreuen können, vorzeitig vernichtet werden, weil man aus stumpfer Gleichgültigkeit die allereinfachsten Maßnahmen, sie vor zerstörenden Einflüssen zu schützen oder beginnende Schäden auszubessern, unterlassen hat. Wie viele Kirchen findet man, wo von unten das Grundwasser, von oben durch das schadhafte Dach der Regen eindringt, wo das Dachgebälke fault, wo nie gelüftet wird, so daß der Schimmel über all wuchert, wo die Altäre aus dem Leim gehen, ohne daß jemand daran denken würde, die gelockerten Teile zu befestigen, die Altargemälde wie Fahnen in den Rahmen flattern und von den Altarkerzen verbrannt werden. Was man schon aus ökonomischen Rücksichten in einem halbwegs geordneten Haushalt nicht dulden würde, das findet man oft in Gotteshäusern, und wo es sich gar um Bauten oder Werke der bildenden Kunst handelt, die nicht mehr in Benutzung sind, da wird oft auch nicht ein Schritt getan, um sie vor Verfall und Zerstörung zu bewahren.
Auch das ist eine unentschuldbare Pflichtverletzung.
2. Schädigung des alten Denkmalbestandes aus Habsucht und durch Betrug
Eine nicht minder große Gefahr für alte Kunstwerke bedeutete seit jeher und bedeutet heute noch weit mehr als in früheren Zeiten Habgier und Gewinnsucht. In früheren Jahrhunderten hat man hauptsächlich des Materials wegen alte Denkmäler vernichtet, indem man z. B. Bauwerke als Steinbruch benutzte, Statuen zerschlug, um Kalk zu brennen, Goldschmiedearbeiten einschmelzen ließ. Das kommt heute wohl nur mehr ausnahmsweise vor, weniger deshalb, weil man alte Kunstwerke mehr schätzt, sondern weil man die Erfahrung machte, daß aus ihnen ein weit größerer materieller Gewinn zu ziehen sei, wenn man sie an Händler oder Sammler verkauft.
Es ist eine leicht erklärliche Erscheinung, daß mit der Überzeugung, daß alte Kunstwerke ihrer künstlerischen Form oder historischen Bedeutung wegen wertvoll sind, auch das Bestreben wächst, sie zu besitzen, sei es, um sich daran zu erfreuen, oder, was häufiger vorkommt, aus Eitelkeit und Ruhmsucht, um mit dem kostbaren Besitze prahlen zu können. Das ist nichts Neues, da schon im XVII. und XVIII. Jh. von Sammlern für alte Kunstwerke sehr hohe Preise bezahlt wurden, aber es handelte sich dabei doch nur um einige wenige Sammler und um eine relativ geringe Anzahl von Kunstwerken und zumeist um heimatlose Gegenstände, die schon lange im Handel waren. Seit dem vorigen Jahrhundert erreichte jedoch der Antiquitätenhandel einen Umfang und eine Gestalt, die ihn als eine der größten Gefahren des alten Kunstbesitzes erscheinen lassen. Man begnügt sich nicht mehr mit Gegenständen, die auf normalem Wege in den Kunsthandel gelangen, sondern alte Kunstländer werden von Händlern systematisch ausgeraubt. Es sind hauptsächlich zwei Ursachen, die dabei mitwirken. Die eine liegt darin, daß Länder und Gebiete, die, wie Amerika oder auch einzelne Teile Europas, an der alten Kunstentwicklung keinen oder geringeren Anteil hatten, sich durch Erwerb fremder, anderswo entstandener Kunstschätze eine höhere kulturelle Bedeutung verschaffen wollen. Die zweite ist darin zu suchen, daß überall durch Industrie und Handel plötzlich reich gewordene gesellschaftliche Klassen und einzelne Menschen, die bisher keinen alten Kunstbesitz hatten, sich ihn um jeden Preis zu erwerben suchen, um sich durch Meisterwerke der alten Kunst, die man heute so hochschätzt, den ihrem Vermögen entsprechenden äußeren Glanz zu verschaffen.
Das führte aber dazu, daß alte Kunstwerke ein Spekulationsobjekt geworden sind, dessen kommerzielle Bewertung sich nach der jeweiligen Nachfrage richtet. Es wird mit Kunstgegenständen, die gerade in Mode sind, nicht nur ein beispielloser Schacher getrieben, von dem nur die Händler Profit haben, sondern es werden auch, da der bewegliche Vorrat nicht ausreicht, alle Mittel: Überredung, List, Betrug und Gewalt angewendet, um den Eigentümern oder Verwesern alter Kunstwerke dieses kostbare Gut unter den verschiedensten Vorspiegelungen herauszulocken. Ganze Scharen von Agenten durchziehen bei uns jahrein, jahraus das Land und wenden die verschiedensten Tricks an, um ihr Ziel zu erreichen. Sie wissen, wann Kirchenvisitationen stattfinden werden, und reden dem unerfahrenen Seelsorger ein, er müsse, um den Kirchenfürsten würdig zu empfangen, das Gotteshaus von allem alten Gerümpel säubern, das aus besonderer Gefälligkeit abzukaufen sie geneigt wären. Oder sie schützen patriotische Beweggründe vor, indem sie behaupten, daß sie die Kunstwerke für Museen und hochstehende Sammler zu erwerben beauftragt sind.

Und gelang es ihnen, dieses oder jenes Kunstwerk zu entwurzeln und zu verschleppen, so beginnt erst recht der Wucher. Alle Tonarten der Reklame werden gespielt und die Preise werden künstlich hochgetrieben wie bei einer Börsenspekulation, wobei im gleichen Maße der ursprüngliche Besitzer des Kunstwerkes, der letzte Käufer und die Allgemeinheit betrogen werden. Es ist der Kirche unwürdig, wenn sie ihre alten Kunstwerke verkauft, und sie untergräbt dadurch ihre Autorität und ideale Mission nicht minder, wie wenn sie mit der religiösen Tradition einen Handel treiben würde. Oft ist diese Pietätlosigkeit zugleich auch eine Simonie, d. h. unerlaubter Verkauf von sakralen Gütern, persönlichen Vorteilen zuliebe und fast immer eine unverantwortliche Schädigung des kirchlichen Vermögens. Wie der Verkäufer, ist auch der Käufer zumeist geschädigt, da er nicht nur von den Zwischenhändlern übervorteilt und an der Nase herumgeführt wird, sondern in vielen Fällen auch nicht, wie er glaubt, als ein Kunstfreund, sondern als ein Kunstfeind handelt, da er den Kunstwerken einen beträchtlichen Teil ihres Wertes raubt, der an ihren Entstehungs- oder Bestimmungsort gebunden ist, und da er jene wahnwitzige Preissteigerung unterstützt, die, überall demoralisierend wirkend, daran schuld ist, daß kunstreiche Orte und ganze Länder mehr als je früher durch Kriegsbanden, heute durch Händler geplündert werden und sich allmählich künstlerisch in trostlose Wüsten verwandeln.
Dies nach Möglichkeit zu verhindern, ist die Pflicht eines jeden Menschen, dem Heimatliebe und Kultur nicht leere Worte bedeuten.
3. Zerstörung alter Kunstwerke durch Missverstandene Fortschrittsideen und Forderungen der Gegenwart
Ein nicht minder großes Unheil richtet der vermeintliche Gegensatz zwischen Fortschritt und alten Denkmalen an.
Man vernichtet noch immer alte Kunstwerke oft nur deshalb, weil sie alt sind und weil man sie für unwürdig der „neuen Zeit“ hält. Man war im vorigen Jahrhundert vielfach der Meinung, und das hat auch heute noch nicht aufgehört, daß die Mißachtung alter Denkmäler zum Fortschritt gehöre und ein Beweis der freiheitlichen und volksfreundlichen Gesinnung sei. Man hielt und hält es in manchen Kreisen geradezu für eine bürgerliche Pflicht und Tugend, mit dem „alten Plunder“ möglichst aufzuräumen und alles zu beseitigen, was an die Vergangenheit, an frühere politische, gesellschaftliche oder kirchliche Verhältnisse oder auch nur an eine künstlerisch durchgebildete Lebensführung erinnert, deren Spuren man als einen unangenehmen Vorwurf empfindet. So werden häufig aus politischen oder anderen Parteigründen alte Wappen, Heiligenstatuen, Gedenksteine zerschlagen oder beseitigt, und alte Stadtmauern, Türme, Gärten nur deshalb zerstört, weil man glaubt, dadurch zu beweisen, daß man mit „der Zeit zu gehen“ versteht. In der Wirklichkeit beweist man aber durch solche Vandalismen nur Unbildung und kulturelle Rückständigkeit.
Noch häufiger sind es die angeblichen Forderungen der Zeit, denen man einzelne Denkmäler, ja ganze Städte opferte und opfert. Die Umwandlung des Lebens auf einer neuen technischen Grundlage, die sich seit etwa hundert Jahren vollzieht, führte zu einem Götzendienst der technischen Neuerungen, der nicht nur andere Rücksichten vergessen läßt, sondern oft darüber hinausgeht, was auch rein technisch nützlich und opportun ist.
Es ist sicher richtig, daß alte Häuser vielfach nicht nur unbequem, sondern auch unhygienisch sind. Doch es ist weder notwendig noch klug, sie deshalb der Reihe nach niederzureißen, da sie in der Regel mit verhältnismäßig geringen Opfern bequem und allen Gesundheitsregeln entsprechend eingerichtet werden können und da sie vielfach Vorteile besitzen, die bei Neubauten gar nicht oder nur mit sehr großen Kosten zu erreichen sind. Die schönen geräumigen, solid gebauten Wohnräume werden bei Neubauten sehr oft durch enge und beengende nicht Wohnungen, sondern Gefängnisse mit dünnen Wänden, die keinen Schutz gegen Kälte und Hitze bieten, die alten großen, freundlichen Höfe mit Bäumen und Rasenflächen durch schmale finstere Lichthöfe, die eine Brutstätte von Krankheiten sind, ersetzt. Man kann nicht dagegen einwenden, daß man ja auch die Neubauten mit ähnlichen Vorzügen ausstatten kann, wie sie manche alte Häuser besitzen. Das unterliegt keinem Zweifel, doch dann braucht man diese Häuser nicht umzubauen, sondern kann sie nach entsprechenden Adaptierungen erhalten. Und dasselbe, was für einzelne Häuser gilt, gilt auch für ganze Städte.
Die ungeheuren Umwälzungen in allen Lebensbedingungen und ihren technischen Voraussetzungen führten dazu, daß die großen Städte eine Ausdehnung wie nie früher und eine ganz neue Bedeutung erhalten haben. Die alten Haupt- und Residenzstädte waren, was der Name besagt, nämlich das kulturelle und administrative Zentrum des Landes, in ihrer äußeren Gestalt durch die allmähliche historische Entstehung und durch zielbewußten künstlerischen Ausbau bestimmt. Die Riesenstädte der Gegenwart gestalten sich aber immer mehr zu Erwerbszentren, in denen mehr oder weniger schonungslos das meiste von dem, was sich aus der Vergangenheit erhalten hat, den heutigen Erwerbsbedingungen, wie Verkehrsmitteln und Verkehrswegen, Geschäfts- und Warenhäusern, billigen Massenquartieren, geopfert wird. Diese Umwandlung kam so schnell, daß man sich vielfach weder die Zeit noch die Mühe nahm, nachzuprüfen, was wirklich notwendig war, und blind und sinnlos die alten Städte zerstörte, um sie durch neue zu ersetzen, die zum großen Teil wie Wildwestgründungen nicht nur ihrer künstlerischen, sondern auch ihrer praktischen Bedeutung nach kaum mehr als vorübergehende Provisorien sein können. Es wäre sicher unbillig und kurzsichtig, wenn man verhindern wollte, daß bei den Großstädten den neuen Bedürfnissen Rechnung getragen werde, doch vielfach handelte es sich gar nicht darum, sondern um eine ganz schablonenhafte Umgestaltung, bei der durch neue, einfach mit dem Lineal entworfene Straßen alte Stadtteile zerstört wurden, wo es gar nicht notwendig war oder wo man zumindestens mit gutem Willen vieles hätte retten können, was mutwillig für immer vernichtet wurde. Auch hat es sich allmählich herausgestellt, daß zwischen der wirklich den heutigen Anforderungen und Anschauungen entsprechenden Ausgestaltung der großen Städte und der Erhaltung der alten Teile derselben nicht jener Gegensatz besteht, den man früher angenommen hat, sondern beides sich vereinigen läßt. Dabei werden freilich die sich bietenden Fragen nicht, wie bisher so oft, durch Phrasen von Fortschritt und neuer Zeit beantwortet werden können, sondern von Fall zu Fall auf Grund aller Erfahrungen des heutigen, die alten Denkmäler wo nur möglich erhaltenden Städtebaues von sachkundigen und künstlerisch empfindenden Männern gelöst werden müssen. Es ist die Pflicht der Stadtvertretungen, dafür zu sorgen und keine Opfer und Mühen zu scheuen, wo es sich um das Schicksal alter Bauten und Stadtteile handelt, denn auch für diese, nicht nur für technische Neuerungen sind sie verantwortlich und jedes ohne absolute Notwendigkeit geopferte Denkmal muß ihnen als Zeichen von Unfähigkeit oder Leichtfertigkeit in der Stadtverwaltung angerechnet werden.
Noch deutlicher kann man in kleinen Städten und auf dem Lande beobachten, daß es sich bei den vermeintlichen Forderungen der Zeit, wenn nicht um andere nicht sehr ehrenvolle Ursachen, nur um mißverstandene und kopflos angewendete Schlagworte handelt. In Städten mit einigen tausend Einwohnern, in denen täglich kaum 20 Wagen fahren und Fußgänger leicht zu zählen sind, werden aus Verkehrsrücksichten alte Stadttore, Häuser, Kirchen niedergerissen und breite Straßen angelegt, die das einst anmutige und wohnliche Städtchen als eine abschreckende und ungastliche Parodie einer Großstadt erscheinen lassen. In kleinen Marktflecken werden Häuser gebaut, die, eine Nachahmung der großstädtischen Mietskasernen, dem Orte sein einstiges charakteristisches Gepräge nehmen und nicht nur für das Land nicht passen, sondern in der Regel auch eine große Verschlechterung der Lebensverhältnisse bedeuten. Wie die beweglichen Kunstwerke dem Antiquitätenhandel, so fallen unzählige alte Städte einer solchen falschen Modernisierung zum Opfer, bei der man vergißt, daß technische Neuerungen nicht Selbstzweck sind, sondern nur ein Mittel, den Lebenskampf leichter und das Dasein angenehmer zu gestalten, ihre Berechtigung jedoch verlieren, wo sie diesem Ziele nicht dienen oder andere wichtige Lebensinteressen und Daseinsgüter vernichten. Es war eine beklagenswerte Verirrung, wenn man glaubte, die neuen technischen Einrichtungen wären so wichtig, daß sie mit brutaler Rücksichtslosigkeit ganz in den Vordergrund gestellt werden können und z. B. einer Fabrikanlage, einer Eisenbahn alles andere weichen oder eine Flußregulierung so durchgeführt werden müsse, daß von der alten Schönheit der Uferortschaften nichts übrigbleibt. Man kann dieselben praktischen Ziele fast immer ohne solche Verwüstungen erreichen und private oder öffentliche Unternehmer, Verwaltungen und Behörden, die sich nicht darum bemühen, müssen als pflichtvergessen und gemeinschädlich bezeichnet werden.
4. Zerstörung alter Denkmäler aus falscher Verschönerungssucht
Wie dem mißverstandenen Fortschritte, so fallen auch einer falschen Verschönerungssucht viele alte Denkmäler zum Opfer, und zwar sowohl in der kirchlichen als auch in der profanen Kunst.
In früheren Zeiten war das künstlerisch Wertvollste, Höchste gerade gut genug, um Gotteshäuser zu schmücken. Heute scheint sich dies ins gerade Gegenteil verwandelt zu haben, da man in den Kirchen so oft das Gute zerstört, um es durch schlechte Fabrikware zu ersetzen. Gewöhnlich spielt sich der Vorgang folgendermaßen ab. Man beginnt Geld für die „Verschönerung“ der Kirche zu sammeln. Sind einige hundert Kronen beisammen, werden Preislisten bestellt und man wählt aus ihnen neue Altäre, Bilder, Beichtstühle, Orgeln, die man, ohne kunstverständigen Rat einzuholen, kommen läßt. Die alte Einrichtung wird vernichtet oder verkauft, und die alten schönen Kunstwerke schmücken dann oft den Salon eines Millionärs, während das Gotteshaus als angestrebte Verschönerung und Ersatz für die alten Kunstgegenstände einen Schund erhält, den jeder, der nur eine Ahnung von wirklicher Kunst hat, nur mit Entrüstung als eine unwürdige Verunstaltung und als ein Zeugnis des künstlerischen Tiefstandes der kirchlichen Kunst betrachten kann. Außerdem werden die Wände mit Malereien bedeckt, die für ein Varieté zu schlecht wären, die Fenster mit schreienden, abscheulichen Glasgemälden verglast, der Fußboden mit Schamotteplatten, wie man sie in Badeanstalten sieht, gepflastert. Dieser Triumph der Geschmacklosigkeit, dessentwegen man all das zerstörte, was vorangehende Generationen im edlen Wetteifer geschaffen haben, wird als ein freudiges Ereignis und als eine fromme Tat gefeiert. In Wirklichkeit sind solche Verschönerungen ein beklagenswerter Verlust und, mag die Absicht noch so gut gewesen sein, ein großer Fehler, der sich zumeist in kurzer Zeit schon rächt. Denn der Talmiglanz der Fabrikware verblaßt schnell, die wertlosen Einrichtungsstücke sind so unsolid gearbeitet, daß sie in wenigen Jahren auseinanderfallen und die künstlerisch wertlose Ausschmückung wird, nachdem sie den Wert der Neuheit verloren hat, auch denen unleidlich, die sie verschuldet haben. Man verteidigt solche falsche Verschönerungen gewöhnlich mit einem Hinweis auf den Wunsch der Bevölkerung, die daran Gefallen findet, oder mit der Behauptung, die alte Einrichtung sei viel zu einfach und unansehnlich gewesen. Die Bevölkerung hat zumeist kein selbständiges Kunsturteil, ihr gefällt das Neue, weil es neu ist, und selbst wenn tatsächlich die neuen wertlosen Machwerke bei ungebildeten Leuten einen gewissen Anklang finden sollten, ist es doch offenkundig falsch, daß man nur auf sie Rücksicht nimmt, indem man das zerstört, was kunstsinnigen und gebildeten Menschen teuer war. Die Kirche hat in allen Zeiten während ihres neunzehnhundertjährigen Bestandes die Bevölkerung zum Höchsten, was die Kunst bot, herangezogen und nicht die Kunst der Unbildung geopfert. Die alten Werke der kirchlichen Kunst haben, mögen sie kostbar oder schlicht, reich oder einfach sein, Stil und Charakter, man empfindet ihnen gegenüber, daß sie künstlerischer Sinn mit Liebe, Sorgfalt und Überlegung geschaffen hat, der Genius loci, die bodenständige Überlieferung und die allgemeinen Errungenschaften der Kunst sprechen aus ihnen, wogegen die Mehrzahl der Gegenstände, denen sie weichen müssen, nicht etwa Schöpfungen einer neuen kirchlichen Kunst, sondern öde und heimatlose Kunstsurrogate ohne Eigenart und künstlerischen Inhalt sind, deren Urheber und Verkäufer zumeist zur Kirche und Kunst gar kein Verhältnis haben, sondern ähnlich wie die Antiquitätenhändler nur ein Geschäft machen wollen.
Auch Gemeindeverwaltungen und Privatbesitzer richten durch verständnislose Verschönerungssucht sehr viel Unheil an. Wie viele alte schöne Rathäuser oder andere öffentliche Gebäude wurden in den letzten Jahrzehnten niedergerissen und durch dem „Ansehen der Stadt entsprechendere“ Neubauten ersetzt, bei denen das würdigere Aussehen darin besteht, daß mit einem Zinskasernentypus nicht von Künstlern, sondern von Bauunternehmern aus Vorlagebüchern stammende Formen und Ornamente, die gerade in Mode sind, sinnlos verbunden werden. Während die alte bürgerliche Kunst bescheiden und zweckentsprechend war, eine gute lokale Handwerkerkunst, will man heute überall großstädtische Paläste haben, denen man die alten schönen Bürgerhäuser opfert und die, da man für wirkliche Paläste weder Geldmittel besitzt noch Künstler heranziehen kann, zumeist zu abstoßenden Mißgeburten der Baukunst sich gestalten. An Stelle der alten bodenständigen Kunst, ihre Werke vernichtend, tritt, durch diese falsche Prunksucht hervorgerufen, eine trostlose Gleichmacherei, die alten Orten ihre Schönheit raubt und sie in künstlerisch hohle, langweilige Allerweltsstädte verwandelt.
Es muß noch darauf hingewiesen werden, daß sehr oft die „Modernisierung und Verschönerung“ der Stadt nur ein Vorwand ist, während die eigentliche Ursache der Nutzen ist, den Bauspekulanten aus solcher Umgestaltung zum Schaden der Allgemeinheit ziehen, wogegen sich alle, denen das künstlerische Bild der Heimat wirklich am Herzen liegt, auflehnen sollten.
II. Der Wert des alten Kunstbesitzes
Nachdem wir gehört haben, welche Gefahren den alten Kunstbesitz bedrohen, ist es notwendig, noch darauf hinzuweisen, wie sehr es sowohl aus idealen als auch aus ökonomischen Gründen notwendig ist, überall mit allen Mitteln diese Gefahren zu bekämpfen.
Es handelt sich dabei nicht nur, wie manchmal angenommen wird, um ein Interesse der Gelehrten und Kunstliebhaber. Gewiß ist es für die Kunstgeschichte von größter Wichtigkeit, daß ihre Quellen, die Denkmäler der alten Kunst, vor der Zerstörung geschützt werden, und ohne Zweifel bedeutet die Vernichtung alter hervorragender Kunstwerke einen unermeßlichen Verlust für alle, die der Kunst ihr Leben geweiht haben. Doch daneben handelt es sich um etwas, was unvergleichlich wichtiger ist und für alle Menschen eine Bedeutung hat, ob sie nun gelehrt und kunstverständig sind oder nicht.
Unser ganzes Leben ist wie nie früher von materiellen Bestrebungen und Einrichtungen durchdrungen: Industrie, Welthandel, technische Errungenschaften beherrschen es weit mehr als geistige Gewalten, so daß ein Zurückbleiben nach dieser Richtung hin sicher nicht zu befürchten ist. Doch es ist merkwürdig. Je mehr die Industrialisierung des Lebens fortschreitet, um so mehr wächst auch die Überzeugung, daß damit allein nicht den Lebensnotwendigkeiten Genüge geschieht, und die Sehnsucht nach Freuden und Empfindungen, die den Menschen über den materiellen Kampf ums Dasein erheben, wird immer mächtiger. Niemand wird leugnen, daß elektrische Straßenbahnen, breite Automobilstraßen, Lift und Telephon, Banken und Fabriksanlagen sehr nützliche Dinge sind und überall eingeführt zu werden verdienen, man wird sich jedoch heute auch immer mehr dessen bewußt, daß, da der Mensch keine Maschine ist, nicht darin allein sein Wohl beruht, und wer aufmerksam zu beobachten weiß, dem wird nicht entgehen, daß neben den materiellen Errungenschaften all das, was nicht nur mit dem Maßstabe der technischen Leistungen oder des materiellen Nutzens bemessen werden kann: von den allgemein verständlicher Schönheiten der Natur bis zu den Tiefen einer neuen ernsten und idealen Lebensauffassung, von Tag zu Tag immer mehr an Bedeutung gewinnt. Zu den neuen Idealgütern gehört aber auch als eines der wichtigsten der alte Kunstbesitz, als Quelle solcher Eindrücke, welche ähnlich wie Naturschönheiten im Beschauer eine über den Alltag und dessen materielle Sorgen und Bestrebungen sich erhebende Stimmung auszulösen vermögen.
Diese Eindrücke können der verschiedensten Art sein. Sie können auf dem allgemeinen Kunstwert der Denkmäler beruhen, auf ihrer Wirkung in der Landschaft, auf ihrem Zusammenhange mit einem Ortsbilde, auf den Erinnerungen, die sich an sie knöpfen, oder auf dem Altersspuren, die sie adeln und zugleich im Beschauer Vorstellungen vom Werden und Vergehen erwecken. Darin liegt der größte Wert der heutigen Freude an alten Kunstwerken, daß sie nicht auf bestimmte Denkmälergruppen oder Menschenklassen beschränkt ist. Eine einfache Dorfkapelle, eine efeuumsponnene Ruine, ein altes Landstädtchen kann uns nicht minder Genuß bereiten wie eine stolze Kathedrale, ein fürstlicher Palast oder ein reichhaltiges Museum. Und dieser Genuß ist allen zugänglich, die geistiger Genüsse überhaupt fähig sind. Nicht nur einzelne Werke der alten Kunst haben an Wert gewonnen, sondern alles, was alte Kunst geschaffen hat, wurde uns kostbar, und zwar nicht als eine Summe von historischen Tatsachen oder künstlerischen Vorbildern, sondern als ein lebendiger Inhalt unseres ganzen Geisteslebens.
Das drückt sich vielleicht am deutlichsten aus in dem rapid wachsenden Besuche alter Städte oder der Städte, die alte Denkmäler enthalten. Die auf seinen Denkmälern beruhende Schönheit eines Ortes würde nicht minder zum Anziehungspunkt für die Allgemeinheit als die landschaftliche Schönheit einer Gegend, und es ist schon deshalb aus rein wirtschaftlichen Gründen gemeinschädlich, alte Denkmäler zu zerstören, da modernisierte, schablonenhaft umgebaute, ihrer Denkmäler beraubte Orte und Länder niemand aufsuchen wird.
Die künstlerische und geistige Verarmung, die mit solchen Verwüstungen verbunden ist, bedeutet freilich einen noch weit größeren Verlust als die wirtschaftliche. Es kann nicht jeder weite Reisen machen, um in der Ferne alte Kunstwerke aufzusuchen, und man bringt viele Menschen überhaupt um alles, was ihnen alte Kunst bieten kann, wenn man die Kunstdenkmäler ihrer Heimat vernichtet. Man verarmt ihr Leben, wenn man ihre Umgebung künstlerisch verarmt, und löst die engsten Bande, die sie sonst reit der Heimat verbunden haben.
III. Der Umfang des Denkmalschutzes
Dieser neue Wert, den alte Kunstwerke für unser ganzes Leben gewonnen haben, verleiht dem Denkmalschutze eine allgemeine Bedeutung. Er beruht nicht nur auf dem Bestreben, Kunst und Wissenschaft zu schützen, sondern ist zugleich vom Standpunkte der allgemeinen Volksbedürfnisse so notwendig, wie etwa die Fürsorge für das Schulwesen. Es ergibt sich aber aus dem Gesagten auch, daß sich der Denkmalschutz nicht nur auf einzelne hervorragende Kunstwerke beschränken kann, sondern alles umfassen muß, was als künstlerisches Gemeingut im oben dargestellten Sinne angesehen werden kann. Und das Geringe bedarf da oft mehr des Schutzes als das Bedeutende. Es dürfte kaum jemand so töricht sein, Gemälde von Dürer oder von Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beantragen. Doch überall bedroht ist das, was nicht in den Handbüchern der Kunstgeschichte hundertfach abgebildet und in den Reiseführern mit einem Stern versehen ist und doch des Schutzes bedarf, weil es in seinen Grenzen nicht minder veredelnd wirkt und unersetzlich ist wie die weltberühmten Kunstwerke.
Ebensowenig wie nur auf die berühmten Kunstwerke darf der Denkmalschutz auf diesen oder jenen Stil beschränkt sein. Als man sich im vorigen Jahrhundert eifriger mit der alten Kunst zu beschäftigen begonnen hat, ließ man sich dabei gewöhnlich von einseitiger Vorliebe für diesen oder jenen Stil leiten, den man unter dem Einflusse der jeweiligen künstlerischen Richtung für den einzig berechtigten erklärte. So gab es Klassizisten, Gotiker, Renaissancebewunderer,

die nur den griechischen, den gotischen, den Renaissancestil für den allein wahren und schönen hielten. Diese Einseitigkeit der Künstler und Kunstschriftsteller war aber in doppelter Beziehung sehr unheilvoll für die Denkmalpflege. Einmal blieb man bei der Vorliebe für einen bestimmten Stil nicht stehen, sondern verdammte zugleich als eine Verirrung und Geschmacklosigkeit jeden andern. Besonders der Barockstil, als der jüngste von den historischen Stilen und als jener, von dem man sich abgewendet hat, um zu den Formen früherer Kunstperioden zurückzukehren, wurde fast allgemein verurteilt, was zur Folge hatte, daß barocke Kunstdenkmäler nicht nur als angeblich minderwertige aus dem Denkmalschutze ausgeschlossen waren, sondern auch ihre Beseitigung als künstlerische Forderung aufgestellt wurde. Viele barocke Gebäude, Statuen, Gemälde sind dieser Forderung zum Opfer gefallen.
Noch verhängnisvoller war eine zweite Folgerung, die man aus diesem Stildogmatismus gezogen hat. Da man nur einen Stil für berechtigt hielt, erklärte man, daß bei Bauwerken, die nach und nach in verschiedenen Zeiten entstanden sind und ausgebaut oder umgebaut wurden oder anderen Ausschmückung und Einrichtung verschiedene Zeiten beteiligt waren, alle späteren dem ursprünglichen Stile widersprechenden Zutaten oder Umänderungen beseitigt werden müssen. Besonders in der kirchlichen Kunst hatte diese Anschauung die größten Verheerungen zur Folge. Denn alte Kirchenbauten waren fast nie stilistisch einheitlich, da sie entweder aus praktischen Gründen oder durch das Bestreben, sie ansehnlicher zu gestalten, zumeist eine neue Gestalt und eine neue Ausschmückung bei Belassung des alten Kerns erhalten haben, ja vielfach zum Spiegelbild des künstlerischen Schaffens vieler Generationen und Jahrhunderte geworden sind. Dies hat man als eine Verunstaltung bezeichnet, und in unzähligen Kirchen wurde alles zerstört oder entfernt, was dem ursprünglichen Stile des Baues nicht entsprach, und durch Nachahmungen in diesem Stil ersetzt. Die prunkvollsten und schönsten Altäre, die reichsten Stukkaturen, die wichtigsten Skulpturen und Gemälde wurden diesem falschen Grundsatz geopfert, was bei uns in Österreich besonders beklagenswert ist, weil unsere Kirchen zum großen Teil im XVII. und XVIII. Jh. ihren reichen Schmuck erhalten haben. Auch die baulichen Veränderungen, die die Kirchen im Laufe der Zeiten erfahren haben, versuchte man in unzähligen Fällen unter dem Schlagworte der anzustrebenden Stileinheit und Stilreinheit ungeschehen zu machen, indem man die Anbauten aus späteren Zeiten demolierte und die umgebauten Teile in dem „ursprünglichen Stile“ ; neu ausführte. Daß dadurch fast immer den alten Bauwerken ein unersetzlicher Schaden zugefügt wurde, sieht man heute allgemein ein, da jedoch solche Bestrebungen besonders bei der Geistlichkeit noch immer nicht ganz verschwunden sind, ist es notwendig, darauf hinzuweisen, wie falsch die Voraussetzungen sind, auf die sie sich stützen.
Es ist vor allem falsch, diesen oder jenen Stil für den einzig berechtigten zu halten, da die Kunst in ihrer tausendjährigen Entwicklung nicht auf Grund einer allgemein gültigen Formel beurteilt werden kann, sondern nach ihren künstlerischen Absichten und Leistungen gewertet werden muß, die naturgemäß in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern verschieden waren. Die Kunst wäre keine Kunst, wenn sie, wie dies die Propheten eines bestimmten Stils im vergangenen Jahrhundert verlangt haben, ihre Werke nach einem Rezept gebildet hätte. Im Zusammenhange mit neuen Bedürfnissen und Anschauungen entwickelte sie sich wie die Sprache und Literatur, und es ist entweder nur eine willkürliche Theorie oder ein unbegründetes Vorurteil, wenn man nur das, was in einer bestimmten Zeit entstanden, für erhaltungswürdig hält, alles andere aber, die Verkörperung des künstlerischen Bestrebens und der künstlerischen Ideale vieler Jahrhunderte, als minderwertig und wert vernichtet zu werden erklärt. Es ist eine lächerliche Anmaßung, eine Kunst, die Werke wie die Karlskirche in Wien oder die Stiftskirche in Melk geschaffen hat, als eine nichtswürdige Pfuscherei zu bezeichnen, und selbst, wenn sich die Vorliebe und das allgemeine Interesse diesem oder jenem Stile mehr zuwenden sollte, so ergibt sich daraus noch lange nicht das Recht, alles andere zu beseitigen, weil einer andern Zeit das angeblich nicht Beachtenswerte sehr wertvoll werden kann, wie wir es ja tatsächlich mit den Werken der Barockkunst erlebt haben.


Oft hat man sich bei der Bevorzugung der einzelnen Stile auch auf Gründe berufen, die weniger mit der künstlerischen Form als mit anderen Gesichtspunkten zusammenhängen, indem man z. B. den gotischen Stil für kirchlicher erklärte als den barocken, was jedoch jeder Berechtigung entbehrt, da der Barockstil mit der größten Blüte des religiösen Lebens verbunden war und besonders in Österreich weit enger mit der heutigen kirchlichen Überlieferung zusammenhängt als die in Frankreich entstandene Gotik des Mittelalters.
Die weitaus überwiegende Mehrzahl jener denen alte Denkmäler Freude und Genuß bereiten, weiß nur wenig von alten Stilen und denkt kaum, wenn sie tiefergriffen eine wunderbare alte Kirche oder ein herrliches altes Stadtbild betrachtet, daran, ob die einzelnen Formen diesem oder jenem Stile angehören. Die Wirkung der alten Denkmäler auf die Phantasie und das Gemüt beruht nicht auf einem Stilgesetz, sie wird hervorgerufen durch die konkrete Erscheinung, die sich aus einer Verbindung allgemeiner Kunstformen mit lokaler und persönlicher Eigenart, mit der ganzen Umgebung und mit all dem, wodurch die geschichtliche Entwicklung das Denkmal zum Wahrzeichen dieser Umgebung erhoben hat, zusammensetzt. Kirchen oder andere Gebäude, Straßen und Plätze, die im Laufe der Zeiten allmählich ihren aus verschiedenen stilistischen Elementen bestehenden künstlerischen Charakter erhalten und bewahrt haben, gleichen beseelten Wesen, wogegen sie alles Lebendige und Anziehende verlieren und sich in langweilige Bilderbuchbeispiele verwandeln, wenn man sie gewaltsam stilistisch vereinheitlicht. So muß sich aber der Denkmalschutz nicht nur auf alle Stile der Vergangenheit erstrecken, sondern überall auch die lokale und historische Eigenart der Denkmäler erhalten, die nach irgendwelchen Regeln zu korrigieren wir nicht befugt sind, weil wir durch solche Korrekturen in der Regel gerade das zerstören, was auch den bescheidenen Denkmälern einen unersetzlichen Wert verleiht.
IV. Falsche Restaurierungen
Es ist auch ein Irrtum, wenn man glaubt, daß durch sogenannte stilgetreue Umbauten und Rekonstruktionen den Bauten ihre ursprüngliche Form gegeben werden kann. Das ist schon deshalb nicht möglich, weil man in der Regel nicht weiß, wie die ursprüngliche Gestalt beschaffen war, und sich damit begnügen muß, sie so auszuführen, wie sie beiläufig hätte sein können. Dieses Beiläufige kann aber nie das wirklich einst Gewesene ersetzen, weil die alten Bauwerke nicht nach einem Schimmel ausgeführt wurden, wie so vielfach die modernen, sondern jedes eine verschiedenartig bedingte künstlerische Lösung war, die man ebensowenig wiederherstellen, wie man einen mittelalterlichen Menschen aus dem Grab erwecken kann.
Doch selbst da, wo man durch diese oder jene Anhaltspunkte darüber unterrichtet ist, wie der Bau ursprünglich gebaut war, ersetzt eine Rekonstruktion nicht das, was von der ersten Anlage im Laufe der Zeiten verloren ging, weil eine Nachahmung überhaupt nie das Original ersetzen kann. Es kommt bei einem Kunstwerk nicht nur auf die allgemeine Anlage an, sondern auch auf die Durchführung. Man kann noch so überzeugt sein, daß dort oder da ursprünglich eine Säule, ein Pfeiler, ein Maßwerk sich befunden habe, die neue Säule, der neue Pfeiler, das neue Maßwerk wird in dem alten Baue doch stets als ein fremdes Element erscheinen, weil die Ursprünglichkeit fehlt, die sich, wie bei einer Handschrift, in jeder Linie zeigt und die auch der gelehrtesten Rekonstruktion nicht verliehen werden kann. Man opfert das echte Ursprüngliche, was spätere Zeiten geschaffen haben, ohne etwas anderes dafür zu erhalten als eine mehr oder weniger plumpe Nachahmung, die, wie jeder Antiquitätenhändler weiß, wertlos ist und die in Verbindung mit alten Kunstwerken in jedem künstlerisch fühlenden Menschen den Eindruck eines unerlaubten Schwindels und einer unerträglichen und abstoßenden Profanation hervorruft.
Weitgehende Umbauten und Rekonstruktionen alter Denkmäler sind daher nicht nur aus dem Grunde zu vermeiden, weil sie wertvolle Denkmäler späterer Perioden zerstören, sondern auch deshalb, weil sie die Gestalt und Erscheinung des Denkmals willkürlich verändern und es dadurch in seiner Wirkung künstlerisch und historisch entwerten.
Dasselbe gilt aber auch für alle Restaurierungen, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen.
Die Mehrzahl der alten Kunstwerke hat sich naturgemäß nicht unbeschädigt erhalten. Alte Architekturen weisen verschiedene Gebrechen auf, die Mauern haben Sprünge bekommen oder sind verwittert, die dekorativen Bauteile wurden defekt, die Altäre morsch, die Altarbilder dunkel und die Wandgemälde haben sich nur in Fragmenten erhalten, werden zu Staub oder lösen sich von der Mauer ab. Solche Schäden müssen selbstverständlich der Erhaltung der Denkmäler wegen nach Möglichkeit behoben werden.
Doch in neunzig von hundert Fällen ging man in den letzten Jahrzehnten über die notwendigen Erhaltungsmaßregeln hinaus. Man sicherte nicht nur bei den sogenannten Restaurierungen das Bestehende, sondern ersetzte auch alles Fehlende und erneuerte das Beschädigte. Burgruinen wurden wieder aufgebaut und in falsche Burgen verwandelt. Fehlende oder beschädigte Architekturteile wurden ergänzt oder erneuert, Statuen wurden überarbeitet, durch Kopien ersetzt oder neu angestrichen und Gemälde wurden nicht mit Sorgfalt vor weiterer Zerstörung bewahrt, sondern einfach übermalt. Durch solche Restaurierungen werden alte Denkmäler nicht vor dem Verfalle geschützt, sondern im Gegenteil in jeder Beziehung zugrunde gerichtet. Sie verlieren, wenn man sie willkürlich verändert, ihre historische Bedeutung und verwandeln sich in sehr unzuverläßliche Zeugnisse von dem künstlerischen Wollen und Können der Vergangenheit, denen mehr oder weniger der Wert der Originalität genommen wurde. Ein übermaltes altes Wandgemälde ist als historisches Denkmal beinahe wertlos und kann mit einer gefälschten Urkunde verglichen werden. Jeder gebildete Mensch weiß, daß man historische Dokumente nicht fälschen darf, doch in der alten Kunst ist es noch immer nicht nur erlaubt, sondern sogar sehr beliebt. Daß durch willkürliche und zuweit gehende Restaurierungen auch der künstlerische Wert vernichtet wird, bedarf wohl keines Nachweises. Aus Werken der alten Kunst werden Werke der Kunst der Restauratoren, die nicht immer die beste ist und die, selbst wenn sie die allerbeste wäre, doch nie ein altes unberührtes Denkmal ersetzen kann, weil wir an alten Kunstwerken alte und nie neue Kunst bewundern wollen. Ein alter gotischer Altar büßt zwei Drittel seines künstlerischen Wertes ein, wenn man die Statuen, die ihn schmücken, überarbeitet und in bunten Farben neu polychromiert, da eine solche radikale Herstellung von dem individuellen Charakter, den jedes echte alte Kunstwerk hat und durch den es sich von Nachahmungen unterscheidet, fast nichts übrig läßt. Vernichtet man aber diesen ursprünglichen Charakter, vernichtet man in den meisten Fällen auch jede andere Wirkung, die ein unberührtes Denkmal auf den Beschauer ausübt. Eine altersgraue Kirche, die man so restauriert, daß sie funkelnagelneu aussieht, indem man die Inneneinrichtung auf den Glanz herrichten, vergolden und staffieren, die Wände blitzblank verputzen oder anstreichen, die Dächer mit Eternit bedecken ließ, verliert fast alles, was vorher ihr Bild lieb und wert erscheinen ließ. Sie gleicht nach der Restaurierung einem langweiligen Neubau, die Poesie, die Stimmung, der malerische Reiz, die sie umgaben, sind verschwunden und das Ergebnis der oft mit großen Kosten verbundenen Restaurierung ist nicht Erhaltung, sondern Zerstörung und Verunstaltung. Solche Restaurierungen, die oft mit empörender Leichtfertigkeit unberufenen Händen anvertraut wurden und denen ebenfalls unzählige alte Kunstwerke zum Opfer gefallen sind, müssen Überall auf das entschiedenste bekämpft werden.
Das besagt jedoch nicht, wie man manchmal einwendet, daß man Kirchen in Museen verwandeln will. Die alten Kunstwerke sind uns unvergleichlich mehr als nur Musealgegenstände. Sie sollen überall unser Leben verschönern, und schon deshalb ist es notwendig, daß sie im steten Zusammenhange mit dem Leben bleiben und nicht als etwas Ausgemustertes, der Gegenwart Entrücktes betrachtet und behandelt werden. Deshalb sollen und müssen auch alle Herstellungen vorgenommen werden, welche notwendig sind, wenn man die Kunstwerke ihrer alten Bestimmung nicht entziehen will. Wie weit man dabei gehen darf, muß der Entscheidung der dazu berufenen Organe überlassen werden, wohl kann aber als allgemeine Regel gelten, daß die Restaurierung nie der Selbstzweck sein darf, sondern nur ein Mittel bedeutet, die Denkmale in ihrem Bestande und in ihrer Wirkung zu sichern und für kommende Geschlechter pietätvoll zu erhalten.
V. Allgemeine Pflichten
Aus den Gefahren, die den alten Denkmalbesitz bedrohen, ergeben sich für die Allgemeinheit Forderungen, die wir noch einmal, da in diesen Fragen die größte Eindringlichkeit notwendig ist, zusammenfassen wollen: Alles, was die Kunst geschaffen hat, ist ein kostbares Produkt und Gut der geschichtlichen Entwicklung, dessen Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit gelegen ist und jedem einzelnen, den Gemeinden und Völkern, der Kirche und dem Staate bestimmte Pflichten auferlegt. Sie gehört zum Pflichtenkreise eines jeden gebildeten Menschen. Wer in Denkmälern nichts anderes sieht als altes „Gerümpel“, das je nach Umständen so bald als nur möglich zu beseitigen oder „nutzbringend“ in der Kalkgrube, bei Neubauten, im Ofen oder beim Trödler zu verwerten sei, ist, welcher sozialen Schichte auch immer er angehören mag, ein roher Mensch ohne Bildung und Erziehung, der nicht anders zu beurteilen und zu behandeln ist, als wenn er sonst irgendwie die elementarsten Rücksichten, die jeder zivilisierte Mensch den idealen Gemeingütern gegenüber haben muß, verletzen würde.
Die Denkmalpflege gehört zu dem Pflichtenkreis der Gemeinden und Nationen. Es gibt kaum eine Gemeinde oder eine Nation, die nicht stolz wäre auf die Werke der heimatlichen Kunst, die man in den Museen vereinigte. Man zeigt sie mit erhebendem Selbstbewußtsein den Gästen und wäre mit Recht im höchsten Maß empört, wenn jemand diese Kunstschätze entwenden oder zerstören wollte. Und doch sind die Museen, so Wertvolles sie auch enthalten mögen, nur ein Nothafen für versprengte Kunstwerke, während das große künstlerische Vermächtnis der kommunalen oder nationalen Vergangenheit in den Denkmälern liegt, die sich an Ort und Stelle eingewurzelt im heimatlichen Boden erhalten haben. Das sehen auch seit langer Zeit schon viele Leute ein, wo es sich um fremde Kunst handelt, indem sie weite Reisen unternehmen, um alte Kunstwerke im Rahmen ihrer Entstehungsvoraussetzungen kennen zu lernen, doch dessen ungeachtet schauen dieselben Menschen müßig zu oder helfen gar, wenn in ihrer Heimat alte Denkmäler zerstört werden, als ob sie dort weniger wertvoll wären als in Italien oder in den Niederlanden. Sie versündigen sich dadurch nicht nur an allgemeinen Kulturgütern, sondern auch ganz besonders an ihrer Vaterstadt und an ihrer Nation, die sie noch weit mehr berauben, als wenn sie das, was in den Museen gesammelt wurde, verkaufen oder zerschlagen würden. Das gilt ganz besonders für die Gemeindeverwaltungen und für alle Organe der nationalen Fürsorge. Es ist ein Pharisäertum, von Heimatliebe zu sprechen und das zu zerstören oder zu verschleudern, was der Heimat außer der Natur ihren sinnfälligen Charakter gibt: die Werke der Ahnen, die sie bewohnt haben, die Spuren des künstlerischen Geistes, der sie befruchtete und der in ihrem Bilde, in ihren Monumenten weiterlebt. Mit Ausnahme einer gewaltsamen Änderung der Sprache könnte ein Volk in seinen geistigen Gütern nichts mehr schädigen als eine gewaltsame Vernichtung seines Denkmalbesitzes. Deshalb ist aber Denkmalschutz zugleich Heimatschutz - in Tat umgesetzte Heimatliebe - und muß überall mit dem größten Nachdrucke gefordert, von den Korporationen und Ämtern durchgeführt und jedem einzelnen anerzogen werden, wo Gemeinsinn, Heimat und nationale Ehre nicht leere Worte sind.
Die Denkmalpflege gehört zu dem Pflichtenkreise der Geistlichkeit, sowohl aus allgemeinen wie auch aus kirchlichen Gründen. Priester, die ohne zwingenden Grund alte Kunstwerke zerstören und verschachern und darin dem Beispiele der Kirchenverwüster folgen, die unter dem Einflusse der französischen Revolution gegen die Zeugnisse der Vergangenheit gewütet haben, setzen sich der Gefahr aus, nicht anders beurteilt zu werden als diese. Sie handeln gemeinschädlich und kulturwidrig auf einem Gebiete der geistigen Bildung, auf dem die Kirche in allen früheren Zeiten die Führung hatte und veredelnd wirkte, und schädigen überdies auch direkt das religiöse Leben, indem sie das Bewußtsein der historischen Kontinuität untergraben und Empfindungen beleidigen, die sie als Quelle einer tieferen Lebensauffassung und Pietät unterstützen sollten.
Schon aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Erhaltung alter Denkmäler auch zu den Pflichten der staatlichen Behörden gezählt werden muß; nicht nur deshalb, weil es sich um allgemeine Kulturwerte handelt, die zu schützen unter allen Umständen zu den staatlichen Obliegenheiten gehört, sondern auch deshalb, weil der alte Denkmalbesitz sowohl materiell als ideell zu den kostbarsten Gütern eines jeden Staatslebens gezählt werden muß, dem mit den monumentalen Zeugnissen seiner Vergangenheit auch die wichtigsten geistigen Stützen der staatlichen Autorität und Erziehung entzogen werden, die ihn von neu entstehenden politischen Bildungen unterscheiden. Deshalb sind staatliche Behörden, welche alte Bauten oder andere Denkmäler ohne zwingenden Grund zerstören oder zugrunde gehen lassen, nicht minder pflichtvergessen, als wenn sie andere öffentliche und staatliche Güter verschleudern würden. Als zwingender Grund können aber fiskalische Gründe nicht angesehen werden, da es sich um höhere Staatsinteressen handelt, die nicht mit dem Maßstabe der Betriebsersparnisse allein bemessen werden können, ja die so wichtig sind, daß staatliche Organe, die dagegen handeln oder auch nur unterlassen sie zu fördern, als illoyal und gemeingefährlich bezeichnet werden müssen.
Dieser hohen Bedeutung des Denkmalschutzes für allgemeine und ganz besonders auch staatliche Interessen entsprechend hat man überall staatliche Institute geschaffen und staatliche Funktionäre bestellt, denen die Obhut des alten Kunstbesitzes anvertraut wurde.
Statt sie zu unterstützen, erschwert man ihnen freilich noch immer oft ihre Aufgabe, indem man sie wie Störenfriede behandelt, die sich in Sachen hineinmischen, welche sie nichts angehen, und die das freie Verfügungsrecht der Besitzer beschränken wollen. Es gibt leider noch immer viele gesellschaftlich hochstehende Persönlichkeiten, die zu sagen pflegen: Ich werde mir doch nicht vom Konservator X oder Y vorschreiben lassen, was ich zu tun oder zu unterlassen habe. Sie vergessen dabei, daß sie in zahlreichen anderen Angelegenheiten, die im öffentlichen Interesse eine staatliche Ingerenz erfordern, z. B. in Fragen der allgemeinen Bauvorschriften, des Wasserrechtes, der Forstwirtschaft, der Hygiene, diese Ingerenz als selbstverständlich und vollständig berechtigt betrachten und deshalb es gar nicht auf sie ankommen lassen, und daß es sich nicht um den Konservator X oder Y handelt, sondern um Erfordernisse und Pflichten, an die ein gut erzogener und gebildeter Mensch ebensowenig erst erinnert werden sollte, wie etwa daran, daß er in Gesellschaft Anstand und gute Sitten nicht verletzen darf.
Man wendet zuweilen ein, die Anschauungen darüber, was vom Standpunkte der Denkmalpflege in diesen oder jenem Falle zu geschehen hat, wären unklar und die Entscheidung sei schließlich Geschmacksache, in der es keine Vorschriften gibt.
Das ist ganz und gar unrichtig.
Was man fordert und überall fordern muß, ist Pietät für den überlieferten Denkmalbesitz und dessen möglichst unverminderte Erhaltung in der alten Umgebung, Form und Erscheinung. Dies ist eine klare eindeutige Forderung, bei der es gar nicht darauf ankommt, wer sie vertritt und auf die erst aufmerksam gemacht werden zu müssen, nicht sehr ehrenvoll ist. Man hat ihr in den meisten Staaten längst eine gesetzliche Form gegeben und wo dies, wie in Österreich, noch nicht der Fall ist, muß um so dringender gefordert werden, daß der gesetzliche Zwang durch guten Willen und gute Beispiele ersetzt werde.
Dies sei auch ganz besonders jenen Sammlern gesagt, deren leidenschaftliches und vom Standpunkte der Denkmalpflege nichts weniger als zu billigendes Begehren, alte Kunstwerke um jeden Preis in ihren Besitz zu bringen, am meisten dazu beiträgt, daß überall der mobile Denkmalbesitz systematisch aus dem Boden, dem er entsprang, herausgerissen und in alle Winde zerstreut wird.
Doch auch an die Künstler muß ein Appell gerichtet werden. Es gibt leider noch sehr viele Künstler, besonders Architekten, die die alte Kunst als ihren Feind betrachten, sei es, weil sie sich von ihr emanzipieren wollen, als ob dies nicht am besten dadurch geschehen könnte, daß sie sie ganz in sich aufnehmen und dadurch künstlerisch bezwingen, sei es, weil sie in ihr eine Konkurrenz für ihre eigenen Werke fürchten. Andere gibt es wieder, die eine Verehrung für alte Kunstwerke heucheln, dabei sie jedoch plündern, indem sie durch schlechte Nachahmungen sie schädigen oder durch rücksichtslose Restaurierungen aus ihnen Nutzen ziehen. All das ist eines wirklichen Künstlers unwürdig und schlägt der neuen Kunst nicht minder tiefe Wunden als der alten. Wer nicht Ehrfurcht hat vor allem, was die Kunst je geschaffen hat, muß es sich gefallen lassen, daß auch seine Kunst leicht genommen wird, wie eine Marktware, die man nur nach Preis und Bedarf schätzt, und wem die künstlerische Eigenart der Kunstwerke der Vergangenheit nicht sakrosankt ist, darf nicht verlangen, daß man einen anderen Maßstab bei seinen Werken anwende.
Mit anderen Worten, und das geht wiederum nicht nur die Künstler an, die Werke der alten Kunst müssen uns mehr sein, als was sie nur ihrer materiellen Bestimmung nach sind, aber auch mehr, weit mehr als nur Antiquitäten, stilistische Vorbilder oder historische Quellen. Sie müssen als ein lebendiger, integrierender Teil unseres Wesens, unseres Werdeganges, unserer Heimat, unserer nationalen und allgemein europäischen Kultur, unserer geistigen und ethischen Errungenschaften und Prärogativen empfunden und so hoch gehalten werden, wie die Schätze der sprachlichen und literarischen Entwicklung, deren Widerspiel sie bilden.
VI. Einige Ratschläge
1. Allgemeine Winke
Die allgemeinen Grundsätze der Denkmalpflege sind so klar und einfach, wie nur möglich. Sie lassen sich, wie schon angedeutet wurde, in zwei Postulate zusammenfassen:
• Die möglichste Erhaltung der Denkmäler in ihrer alten Bestimmung und Umgebung,
• in ihrer unverfälschten Gestalt und Erscheinung.
In der praktischen Durchführung ergibt sich freilich aus diesen Grundsätzen eine Fülle von mannigfaltigen Aufgaben und Pflichten, die durch Regeln nicht erschöpft werden können, zu deren Bewältigung aber immerhin einige bestimmte Ratschläge nützlich sein dürften.
2. Ruinen
Bei Ruinen muß vor allem darauf Bedacht genommen werden, daß nicht das zerstört wird, worauf der eigenartige Reiz der Ruinen beruht. Es ist dies der Charakter eines dem Walten der Zeiten zum Opfer gefallenen Bauwerkes und die malerische Erscheinung in der Landschaft. Eine ausgebaute Ruine ist keine Ruine mehr, sondern ein neues, zumeist mittelmäßiges Bauwerk.
Einige Maßnahmen, um allzu raschem Verfall vorzubeugen:
Risse in den Mauern sind auszufüllen, aus dem Gleichgewicht gekommene Wände zu stützen, mit Einsturz drohende Decken zu pölzen, sich loslösende Teile zu befestigen.
Doch die Stützen sind so anzubringen, daß sie nicht in dem Gesamtbilde der Ruine störend wirken, beim Ausfüllen der Risse und Fugen sind die Wände nicht mit Kalk zu verschmieren, die ausgezackten oberen Ränder der Mauern nicht etwa auszugleichen, sondern in ihrer unregelmäßigen Form zu belassen.
Vegetation ist dort zu beseitigen, wo sie das Mauerwerk sprengt, im übrigen ist sie zu schonen. Notwendige Ein- oder Zubauten sind als einfache, sich dem Gesamtbilde unterordnende Nutzgebäude ohne historisierende Formen auszuführen.
In der Nähe der Ruinen sind keine technischen Betriebe anzulegen, die Erderschütterung hervorrufen oder das Terrain untergraben würden.
3. Erhaltung alter, im Gebrauch stehender Gebäude
Sie erfordern eine ständige Fürsorge, durch die in vielen Fällen weitgehende Restaurierungen vermieden werden können.
Zu den großen Feinden alter Gebäude gehört die Feuchtigkeit, die daher ständig zu bekämpfen ist. Sehr oft liegt ihre Ursache, besonders bei den Kirchen, in mangelhafter Ventilation, so daß überall für eine ständige ausreichende Lüftung zu sorgen ist. Außerdem sind die Dächer in gutem Zustande zu halten. Das Regenwasser muß einen guten Ablauf haben, und die schadhaft gewordene Bedachung ist gleich auszubessern oder zu erneuern.
Wo die Feuchtigkeit im Grundwasser ihren Ursprung hat, müssen entsprechende Entwässerungsanlagen ausgeführt werden.
Zeit und Abnutzung bringen es mit sich, daß bei alten Gebäuden fast immer etwas auszubessern ist. Fußböden werden ausgetreten, Fenster- und Türeinrahmungen verwittern, der Verputz fällt ab. Man darf nicht warten, bis der Schaden einen großen Umfang angenommen hat, da durch rasche Behebung der kleinen Schäden große abgewendet, Kosten gespart und die Denkmäler im guten Zustand erhalten werden können.
Die Ausbesserungen sind jedoch immer so auszuführen, daß sie nicht störend wirken, sondern sich pietätvoll dem alten Charakter des Baues in Material und Form anpassen.
4. Umfassende Erneuerungen
Eine ganz besondere Vorsicht ist notwendig, wo größere Erneuerungen vorgenommen werden müssen, die zwar den Kern des Gebäudes nicht berühren, doch aber für die Erscheinung des Denkmals verhängnisvoll werden können. Dazu gehört in erster Linie die Erneuerung der Bedachung, der Tünche und der Fußböden.
Nicht nur die Form der Dächer, sondern auch das Material und die Farbe der Bedachung spielen in der Außenwirkung eines Denkmals eine große Rolle, weshalb Erneuerungen in demselben Material und womöglich mit teilweiser Benutzung der guten Teile der alten Bedachung erfolgen sollen, ungünstig wirkendes Bedachungsmaterial jedoch, wie Eternit, zu vermeiden ist.
Ebenso sind zu vermeiden grelle unharmonische Wirkungen bei der Erneuerung des Verputzes oder der Tünche von außen oder im Innern. Ein schreiender roter oder gelber Anstrich, wie er oft noch bei alten Häusern oder Kirchen in der geschmacklosesten Weise angewendet wird, verunstaltet das Gebäude für viele Jahre. In der Regel wirkt bei einfachen Bauten ein schlichter grauer Verputz von außen oder eine weiße oder graue Tünche im Innern am günstigsten.
In Haustein ausgeführte Gebäude und Gebäudeteile sind unverputzt zu belassen.
Auch bei den Fußböden ist es wie bei den Bedachungen am besten, Erneuerungen in demselben Material, aus dem der frühere Fußboden bestand, auszuführen. Billige Surrogate, wie bunte Zementfliesen, sind bei Gebäuden und Räumen, welche auf Würde und Monumentalität Anspruch erheben, zu verwerfen.
5. Weitgehende Umgestaltungen und Restaurierungen von alten Gebäuden
Wo sich aus dem schlechten Zustande eines alten Baues oder aus praktischen Gründen die Notwendigkeit ergibt, Arbeiten vorzunehmen, welche die Substanz und die Form des Denkmals berühren, muß unbedingt fachkundiger Rat eingeholt werden.
Es ist jedoch ein Irrtum, wenn man glaubt, daß ein beliebiger Baumeister oder Architekt diesen Rat erteilen kann oder daß die Anwendung von alten Bauformen allein genügt, einen Architekten als geeigneten Fachmann erscheinen zu lassen. Die Restaurierung und Umgestaltung alter Bauwerke erfordert eine besondere Erfahrung und Vertrautheit mit den Grundsätzen und Erfordernissen der Denkmalpflege. Es ist daher dringend geboten, daß sich Besitzer oder Verweser alter Bauwerke, wenn es sich darum handelt, über einfache Ausbesserungen hinausgehende Restaurierungen, Umbauten oder Adaptierungen vorzunehmen, an berufene Organe der staatlichen Denkmalpflege wenden, denen es obliegt, unentgeltlich Ratschläge zu erteilen, ob und wie die geplanten Arbeiten auszuführen wären und wem sie anvertraut werden könnten.
Das gilt auch von Kirchenerweiterungen und Anbauten an alte Schlösser oder Häuser, die nicht von einem beliebigen Bauunternehmer entworfen werden dürfen, sondern bei denen man mit Verständnis und Sachkenntnis auf dem Gebiete der Aufgaben dieser Art verfaßte Projekte anstreben muß, die bei Wahrung der praktischen Bedürfnisse doch dem alten Bestand den geringsten Schaden zufügen und auf die Gesamtwirkung des alten Baues in seiner Umgebung Rücksicht nehmen.
6. Kircheneinrichtung
Wie das Kirchengebäude, verlangt auch das Kirchenmobiliar ständige Pflege. Sie soll sich jedoch in der Regel auf eine vorsichtige Reinigung und Befestigung der sich loslösenden Teile oder Ergänzung kleiner Fehlstücke beschränken. Das leider vielfach noch immer beliebte Bronzieren oder Anstreichen von alten Statuen oder Holzschnitzereien ist ein Vandalismus.
Doch auch das nicht minder verbreitete Neufassen der Altäre, Kanzeln oder anderer Einrichtungsgegenstände, welches in einer neuen Bemalung und Vergoldung besteht, ist als eine Entwertung der Gegenstände und Verunstaltung der Kirche zu verdammen. Bei Beschädigungen der alten Bemalung und Vergoldung genügt gewöhnlich eine sorgfältige Ausbesserung. Auch wo der Erhaltungszustand des Kirchenmobiliars so schlecht ist, daß es als der Kirche unwürdig erscheint oder in seinem weiteren Bestande bedroht ist, darf es nicht voreilig als unbrauchbar verworfen oder irgendeinem Anstreicher zur, „Neuherstellung“ ausgeliefert werden, sondern kann derart restauriert werden, daß es ohne Einbuße an altem künstlerischen Wert seinen Zweck wieder erfüllt und überdies der Kirche zur Zierde gereicht.
Auch da ist eine Anfrage bei den Organen der Denkmalpflege der beste Weg, Mißgriffe und Fehler zu vermeiden.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß einer neuen Orgel wegen nicht immer der alte Orgelkasten zerstört werden muß, sondern sehr oft für die neue Maschine benutzt werden kann, und daß man nicht einen ganz neuen Altar ausführen muß, wenn man das alte drehbare Tabernakel durch ein feststehendes ersetzen will.
7. Skulpturen
Werke der plastischen Kunst werden entwertet und verunstaltet, wenn sie überarbeitet, angestrichen oder neu polychromiert werden. Deshalb dürfen Steinskulpturen nicht abgestockt werden, sondern sind nur, wo es notwendig ist, mit weichen Bürsten zu reinigen.
Das Anstreichen der Statuen oder der plastischen Bauglieder und Dekorationen aus Stein oder Stukko mit Ölfarbe oder Tünche ist unzulässig, da dabei die Materialwirkung wie auch die Schärfe und beabsichtigte Wirkung der Formen verloren geht.
Bei plastischen Metallarbeiten ist auf die Erhaltung der Patina zu achten.
Bei Holzfiguren gilt dasselbe, was über Kircheneinrichtungen gesagt wurde: man vernichtet sie zur Hälfte, wenn man sie der alten Polychromie und Vergoldung beraubt.
Unbedingt muß von berufener Seite Rat eingeholt werden, wo es sich darum handelt, Skulpturen, deren wesentliche Teile zerstört wurden oder die in ihrem Material - z. B. Steinarbeiten durch Verwitterung, Holzarbeiten durch Holzwurm oder Fäulnis - bedroht erscheinen, vor weiterem Verfall zu retten und instand zu setzen.
8. Wandmalereien
Die Mehrzahl der mittelalterlichen Kirchen und prunkvolleren Profanbauten war im Innern und oft auch von außen mit Wandmalereien geschmückt, von denen sich ein großer Teil unter der Tünche erhalten hat. Da solche Wandmalereien nicht nur von großer historischer Bedeutung sind, sondern auch einen kostbaren Schmuck der alten Gebäude bedeuten, ist bei Erneuerungen der Tünche oder bei anderen Arbeiten an den Wänden darauf zu achten, daß man die eventuell noch vorhandenen Wandgemälde nicht beschädigt. Sollten Spuren davon zum Vorschein kommen, darf die Bloßlegung nicht gewöhnlichen Maurern überlassen oder, wie so oft geschieht, vom begeisterten Finder selbst vorgenommen werden, sondern es ist eine Anzeige an die Denkmalbehörde notwendig, die dafür zu sorgen hat, daß die Bloßlegung und Sicherung der Malereien durch einen geschulten Restaurator durchgeführt wird, an den man sich auch zu wenden hat, wenn Wandgemälde, die nie unter der Tünche waren oder schon vor längerer Zeit bloßgelegt wurden, gereinigt oder neu an der Wand befestigt und vor Zersetzung geschützt werden sollen. Läßt man alte Wandmalereien übermalen, so bedeutet dies die Vernichtung ihres historischen und künstlerischen Wertes.
9. Holz- und Leinwandbilder
die man nach Möglichkeit vor Kerzenruß und großen Temperaturwechseln wie auch vor Feuchtigkeit schützen soll, können von Zeit zu Zeit vorsichtig mit weichem Tuch abgewischt werden. Andere Manipulationen sind zu unterlassen.
Sollten aber die Bilder Schaden aufweisen, das Holz springen, die Leinwand sich wellen, die Farbe Blasen bilden oder sich abblättern, dürfen sie ebenfalls nicht einem beliebigen Maler oder Dilettanten anvertraut werden, die oft besonders Geistlichen ihre Dienste anzutragen pflegen und die ihnen anvertrauten Bilder nicht retten, sondern ganz zerstören. Auch unter den sogenannten Restauratoren sind nicht alle der schwierigen und verantwortungsvollen Aufgabe der Restaurierung alter Bilder gewachsen, weshalb auch da die größte Vorsicht notwendig ist und nichts ohne Rat der Denkmalbehörde geschehen soll.
10. Verschiedene Kunstgewerbliche Gegenstände im Kircheninventar
In den meisten Kirchen hat sich eine Anzahl von alten kunstgewerblichen Objekten, Gold- und Silberarbeiten, Meßgewändern, Spitzen, Teppichen, Lampen, Leuchtern usw. erhalten. Sie sind in der Regel viel besser als neue Anschaffungen, weshalb man sie, solange sie im guten Zustande sind, im Gebrauch belassen soll. Sind sie aber so schadhaft geworden, daß man sie nicht mehr benutzen kann, oder wurden sie aus einem anderen Grunde außer Gebrauch gesetzt, soll man sie nicht auf den Dachboden oder in die Rumpelkammer verbannen, wo sie rasch ganz zugrunde gehen oder weggeschleppt werden.
Man bewahre sie vielmehr sorgfältig in geeigneten Räumen unter Verschluß auf. Es werden auf diese Weise mit der Zeit bei den Kirchen kleine Kirchenmuseen entstehen, den Kirchen zur Ehre und zum Nutzen des allgemeinen alten Kunstbesitzes, dem dadurch viel erhalten bleibt, was sonst verloren ginge.
11. Kunsthandel
Neben dem Privatbesitz ist der alte kirchliche Besitz die Hauptquelle des Kunsthandels. Jeder Geistliche soll und muß aber wissen, daß er Kunstwerke von anerkanntem Werte ohne Erlaubnis der höheren kirchlichen Behörden und ohne pflichtgemäße Anzeige an die staatliche Verwaltung zu veräußern nicht berechtigt ist und eine Pflichtverletzung begeht, wenn er dagegen handelt.
Sehr oft werden von Geistlichen alte Kunstwerke bona fide in der Meinung verkauft, daß sie keine besondere Bedeutung haben, wobei die Priester zum Schaden der Kirche und Denkmalpflege betrogen werden. Deshalb sollte sich jeder Priester zum Grundsatz machen, überhaupt nie aus seiner Kirche alte Kunstgegenstände zu verkaufen oder gegen neue zu vertauschen.
Man schenke dem Käufer nicht Glauben, wenn er behauptet, dies oder jenes sei ganz wertlos und er übernehme es nur aus Gefälligkeit oder deshalb, weil er für Gegenstände dieser Art ein besonderes Interesse habe.
Man lasse sich auch nicht durch hohe Summen verführen, die für anscheinend geringfügige Gegenstände geboten werden.
Man beachte nicht die Behauptung der Agenten, dieser oder jener Gegenstand sei der Kirche unwürdig und könnte bei einer Visitation Mißfallen erregen, was zu beurteilen Kunsthändler sicher nicht kompetent sind.
Was Kunsthändler und Sammler besitzen wollen, hat immer einen Wert, der der Kirche beim Verkauf dauernd verloren geht.
Man lasse sich von dem Vorsatze, nichts aus der Kirche zu verkaufen, auch durch einflußreiche Sammler oder durch Kirchenpatrone nicht abbringen.
Mutatis mutandis gelten diese Ratschläge zum großen Teil auch für alle, die für nichtkirchlichen öffentlichen Kunstbesitz verantwortlich sind, und für Privatbesitzer, die ja wohl zum Verkauf ihrer Kunstschätze durch äußere Umstände zuweilen gezwungen werden, die aber im allgemeinen wie in ihrem eigenen Interesse, um sich gegen krasse Übervorteilung zu schützen, nie versäumen sollen, die Kunstwerke, die sie verkaufen müssen, in erster Linie den öffentlichen österreichischen Museen anzutragen.
12. Neue Ausschmückung alter Gebäude
Der größte Schmuck alter Bauten von außen und im Innern ist ihre geschichtliche Form und ihr altes Gepräge. Darauf muß bei jeder Neuausschmückung Rücksicht genommen werden. Besonders in der Neuausschmückung alter Kirchen begeht man da oft große Fehler.
Als das wichtigste Ziel einer neuen Ausschmückung der Kirchen pflegt man eine neue, möglichst reiche Ausmalung und neue, möglichst bunte Glasfenster zu betrachten. Beides kann aber einem alten Bau, statt ihn zu schmücken, den größten Schaden zufügen. In der Regel sind die neue malerische Ausschmückung und die neuen Glasgemälde an und für sich künstlerisch ganz wertlos, eine aus Vorlagebüchern zusammengesetzte unselbständige Sudelei, die die Kirche nicht schmückt, sondern verunstaltet. Dazu kommt, daß das Verständnis und Gefühl für das Zusammenwirken der monumentalen Raumwirkung und der monumentalen Malereien überhaupt als allgemeiner Besitz verloren gegangen ist, so daß in der Regel eine reiche ornamentale oder figurale Ausmalung und neue Glasgemälde in grellen Farben die Innenwirkung alter Bauten nicht wie einst verstärken, sondern zerreißen und zerstören. Deshalb wirkt in allen Kirchen eine einfache Tünchung in einem oder mehreren diskreten Tönen und weißes Kathedralglas in den Fenstern fast immer günstiger und würdiger als eine reiche figurale oder ornamentale Ausmalung oder bunte, neue Glasgemälde.
Wo man jedoch auf einen reichen neuen malerischen Schmuck an den Wänden oder in den Fenstern nicht verzichten zu können glaubt, muß zumindestens dafür gesorgt werden, daß die Entwürfe Künstlern in Auftrag gegeben werden, die nicht nach Schablonen arbeiten, sondern soviel Verständnis und Begabung besitzen, um ein Werk zu schaffen, das selbstständigen künstlerischen Wert hat und dabei mit der monumentalen Gesamtwirkung des Baues und dessen altem Gepräge im Einklang steht.
Nebst der Rücksicht auf die Erhaltung des Bestehenden muß da bei Neuanschaffungen als die erste Regel gelten, nur gute und solide Sachen zu kaufen. Wertloser Tand und Fabrikware gehören nicht in ein Gotteshaus. Damit soll nicht gesagt werden, daß alles, was man anschafft, auch in bescheidenen Verhältnissen teuer sein muß. Man wird fast überall noch Handwerker finden, die für schlichte Landkirchen passende und den verfügbaren Mitteln entsprechende Einrichtungsstücke liefern können und deren Arbeiten, mögen sie noch so naiv oder derb sein, nie so beleidigend wirken werden, wie die charakter- und heimatlosen, von den Kunstfirmen nach allen Windrichtungen vertriebenen Massenerzeugnisse.
Wo jedoch in reicheren Kirchen Kunstvolleres, der alten Bedeutung der großen kirchlichen Kunst Entsprechendes geschaffen werden soll, da darf man nicht glauben, daß dies mit einigen hundert Kronen erreicht werden kann. Statt Minderwertiges zu kaufen, ist es besser, zu warten, bis die Mittel ausreichen, um bei hervorragenden Meistern Werke von bleibendem künstlerischen Werte zu bestellen.
13. Orts- und Stadtbild
So schwierig und mannigfaltig verwickelt die Fragen erscheinen könnten, die mit der Erhaltung der alten, durch zahlreiche neue Forderungen bedrohten Ortsbilder zusammenhängen, so einfach sind doch die Grundsätze, die dabei überall zur Richtschnur dienen sollen.
Man zerstöre nicht Altes nur deshalb, um Neues an dessen Stelle zu setzen.
Man ändere nicht ohne zwingenden Grund die historisch entstandene Anlage der Ortschaften und Städte, die Form der Plätze, die Breite und Richtung der Straßen.
Man zerstöre nicht alte Stadttore, Türme, Stadtmauern, Bildsäulen, selbst wenn sie einige Unbequemlichkeiten bedeuten.
Man opfere nicht alte Bauten dem „Verkehr“, der sich auf dem Lande auch ohne solche Opfer bewältigen läßt.
Man äffe nicht Großstädte nach.
Man baue nicht Häuser oder öffentliche Gebäude mit falschen Prätentionen als Talmipaläste in verschiedenen Stilarten, sondern einfach und praktisch, wie sie früher ortsüblich waren und durch eine lange Tradition erprobt und bodenständig wurden.
Man achte darauf, daß sich jeder Neubau seiner Umgebung und dem Gesamtbilde des Ortes unterordne.
Man schone die Vegetation, die dieses Bild belebt und malerisch gestaltet.
In großen Städten, die in Umbildung begriffen sind und wo die ganze zukünftige Gestalt des Stadtbildes im Spiele ist, betrachte man es als eine selbstverständliche Pflicht, diese Umgestaltung nicht dem Zufall, den materiellen Interessen allein oder dem Gutdünken der gewöhnlichen Bauämter oder Verwaltungsorgane zu überlassen, sondern vertraue sie Männern an, die mit allen nicht nur praktischen, sondern auch ästhetischen Erfordernissen des Städtebaues und den Rechten und Erfordernissen der Denkmalpflege in seinem Rahmen ganz vertraut sind.
14. Wo holt man sich Rat und Hilfe?
Zum Schutze des alten Kunstbesitzes wurde in Österreich ein staatliches Institut eingerichtet. Es ist dies die Zentralkommission für Denkmalpflege, die aus einem Staatsdenkmalamte und aus Landesdenkmalämtern besteht und von einem Stab von ehrenamtlichen Konservatoren und Korrespondenten unterstützt wird.
Diese Ämter sind verpflichtet, in allen Angelegenheiten der Denkmalpflege unentgeltlich zu intervenieren, weshalb man immer und überall ihren Rat und, wo es notwendig ist, auch ihre Hilfe anrufen kann, sei es direkt, sei es durch die Vermittlung der Konservatoren, die die Zentralkommission in bestimmten Bezirken vertreten. Ihre Namen und Adressen kann man bei den Bezirkshauptmannschaften erfahren.
*

